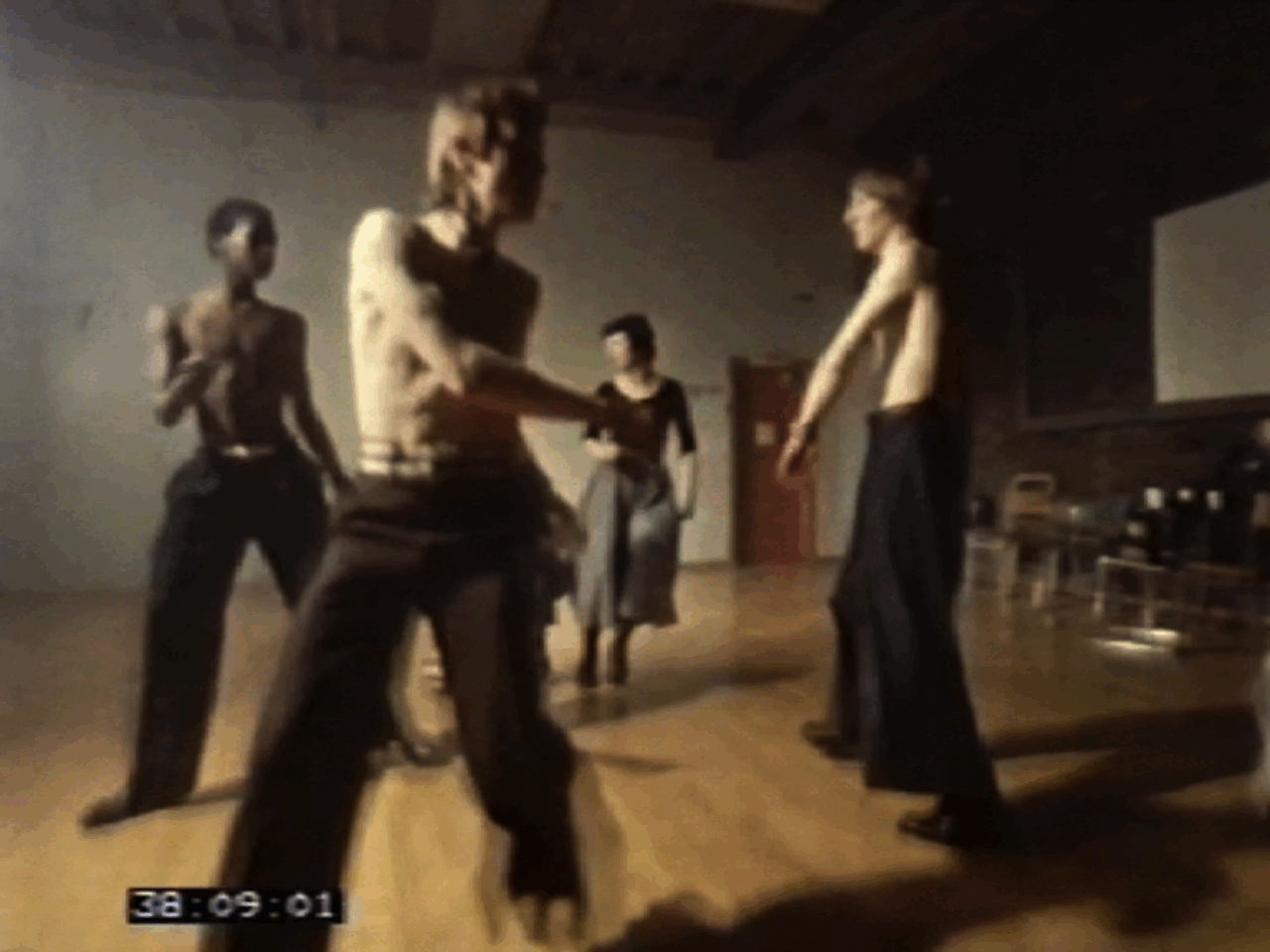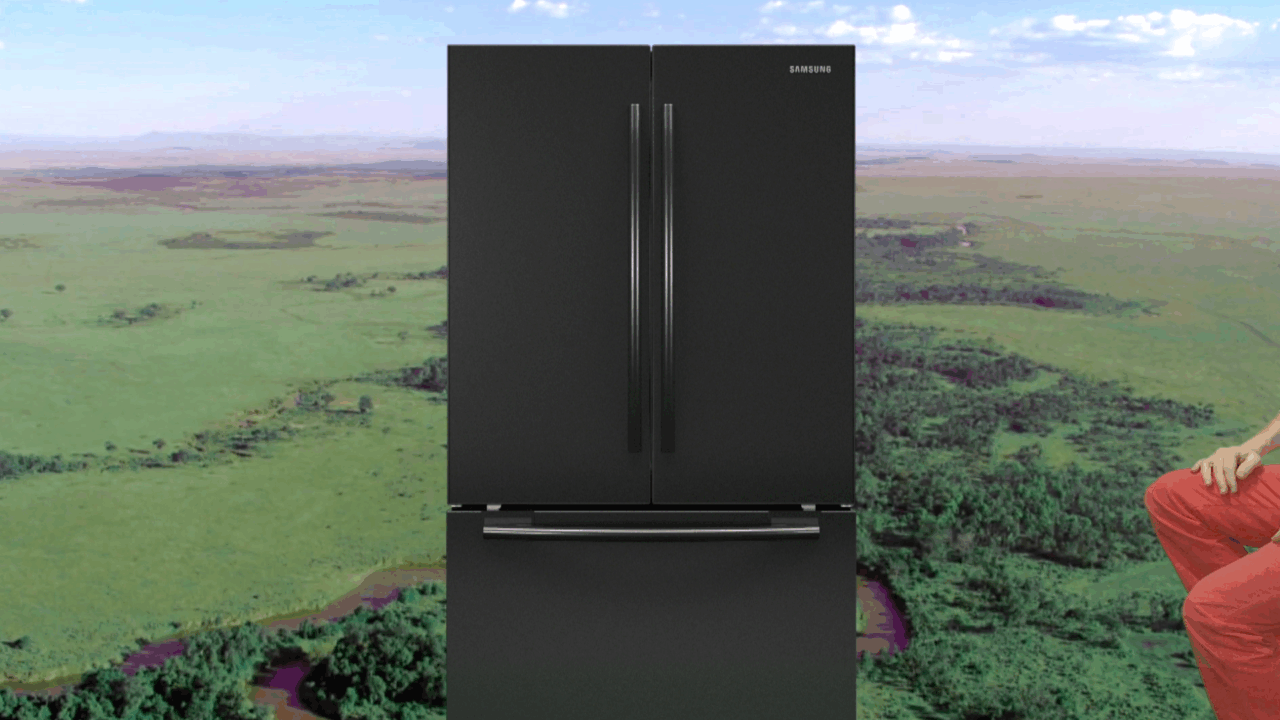Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.
Nostalgie ist ein starkes Gefühl. Wie sonst sollte man erklären, dass große Teile von Popmusik nach vergangenen Jahrzehnten klingen, wo sie doch genauso gut nach der Zukunft klingen könnten, und wie sollte man sich die Jahrzehnte von ästhetisch avancierter Verarbeitung dieses Gefühls erklären? Mark Leckey jedenfalls, der 1964 in Birkenhead bei Liverpool geborene Künstler, nutzte dieses Gefühl in der ersten Hälfte seiner Karriere.
»Ich habe das Ende dieser Nachkriegs-Sozialdemokratie erwischt«, sagt der Künstler in einer Folge des Podcasts ›New Models‹. »Ich war der Erste aus meiner Familie, der auf die Uni gegangen ist, aber eigentlich bin ich nur auf die Kunsthochschule gegangen, weil ich eine Band haben wollte. Es gab alle Voraussetzungen für Subkultur, besetzte Häuser und finanzielle Unterstützung für Studierende.« Nach seinem Studium an der Newcastle Polytechnic war der junge Künstler 1989 in einer Gruppenausstellung mit dem Titel ›New Contemporaries‹ vertreten, die das Londoner ICA jährlich ausrichtet. Neben Leckey zeigten hier auch Damien Hirst und andere aus jener Alterskohorte, die als Young British Artists bekannt wurden. Aber solche vereinfachenden Einteilungen in Generationen können täuschen, denn nicht nur hat Leckey wenig gemeinsam mit anderen britischen Künstler*innen, die Anfang der 1960er geboren sind. Er startete auch nicht sofort eine Karriere in Museen und auf Messen; stattdessen legte er eine Pause ein, lebte ein paar Jahre in Nordamerika, wo er Webseiten programmierte. Beinahe ein Jahrzehnt machte er fast keine Kunst, nur wenige kurze Videoarbeiten über Punk und Subkultur, zusammengeschnitten aus alten Fernsehaufnahmen, deuten schon an, wofür er sich später interessieren würde. Seine Videoarbeit mit dem Titel ›Fiorucci Made Me Hardcore‹ von 1999 ist so etwas wie sein erster Hit, eine Art später Durchbruch.
›Fiorucci‹ ist ein Film wie ein Traum aus verschwommenem VHS-Material von Northern-Soul-Tänzer*innen—stockend, verlangsamt—, und er beginnt mit einem euphorisierenden Synthesizer, aber es setzt kein Beat ein, stattdessen wird der Klang zum statischen Sirren, während die Tänzer*innen in einem viktorianischen Ballsaal Pirouetten drehen und ihre Drops vorführen. »Je mieser ein Bild ist, desto mehr Zugang gewährt es einem«, sagt Leckey. Die da tanzen, sind junge Erwachsene in den 1970ern, die jeden Tag in Fabriken arbeiten. Später, wenn Leckey Material von Raves collagiert, zeigt er auch einen historisch jüngeren Moment: Die Deindustrialisierung ist vollzogen, in den Fabrikhallen, wo die vorherige Generation noch schuftete, wird nun getanzt. Immer wieder gibt es eine Einstellung vom Dach eines Wohnblocks, Sonnenuntergang über einer tristen Industrielandschaft, die Stimmung wehmütig und, ja, nostalgisch und ein bisschen rätselhaft. »Ich bin im Schatten von Liverpool aufgewachsen«, sagte er einmal in einem Interview über die Provinz und die Industriezentren. Seine Arbeiten erzählen von den Verbindungen zwischen Dancefloor und Maschinenhalle, zwischen Jugendzimmer und Archiv, von Großbritannien unter Margaret Thatcher und seinen ausdifferenzierten Subkulturen.
»Je mieser ein Bild ist, desto mehr Zugang gewährt es einem.«—Mark Leckey
Mythische Orte der Jugend
Die späten 1990er waren der letzte Zeitpunkt, an dem man einen Film wie ›Fiorucci Made Me Hardcore‹ unter solchen Bedingungen machen konnte, und es dauerte lange: Freund*innen, die beim Fernsehen arbeiteten, um Kopien von Tapes zu bitten, die Bänder zu digitalisieren und auf einem PC zu schneiden, der unter der Datenlast ständig abstürzte, das war mühsam. Wenige Jahre später hätte leistungsfähige Software die Bearbeitung einfacher gemacht. Die unbegrenzte Verfügbarkeit von Archivmaterial hätte aber auch die Auswahl erschwert. In einem Gespräch sagte einmal der US-Videokünstler Arthur Jafa—dessen monumentale Videoarbeit ›Love Is The Message, The Message Is Death‹ von 2016 ein ganz ähnliches Interesse an Archiven, Pop und Bildproduktion verrät—, dass er nur wenige Stunden für das Schneiden seines Films gebraucht habe. Leckey brauchte ein paar Jahre.
Das Video fiel in eine Zeit, in der Gegenwartskunst geradezu besessen von Archiven und dem Verdauen von Popkultur war. Postmoderne Philosoph*innen lieferten die Theorie zum kulturellen Recycling, Jacques Derridas ›Dem Archiv verschrieben‹ erschien 1995. Vielleicht liegt es auch daran, dass eine kritische Masse an Fernsehbildern und Popmusik verfügbar war, auf die man zurückgreifen konnte. Nur das Internet mit seiner Bilderflut war noch kein Massenmedium.
Leckeys Werk erschöpft sich nicht in diesem einen Video, aber es bereitet viele Themen vor. ›Dream English Kid 1964—1999 AD‹, von 2015, erzählt beispielsweise quasi-autobiografisch von den Beatles—das Video beginnt mit dem ersten Akkord von ›A Hard Day’s Night‹ (erschienen 1964), der hier klingt wie unter Wasser aufgenommen, es erzählt von Joy Division und der Infrastruktur im englischen Norden. In seinen Installationen baut Leckey Bushaltestellen und Autobahnbrücken nach, als beinahe mythische Orte der Jugend. Leckeys Bilder erschöpfen sich auch nicht darin, dass sie Subkulturen aus dem Archiv holen, die man nach Signifikanten von Klasse und Popkultur absuchen und in Kunstgeschichte oder Theorie übersetzen kann. »Manche Bilder sind wie ein Fetisch, und man kommt ihnen nur über das Gefühl nah«, sagt Leckey. Sein Verhältnis zu Sprache und Kritik ist spannungsreich. »Das scheint mir, als müsste man sich vor einem Lehrer verantworten, den man schon lange nicht mehr respektiert.«
Die Ausstellung in der Julia Stoschek Foundation in Berlin ist streng genommen keine Retrospektive, obwohl sie Werke aus den allerletzten Jahren des vorigen Jahrhunderts bis heute zusammenbringt, Videos, Skulpturen und Installationen. Leckeys Arbeiten werden von ihm selbst kuratiert, sodass Brüche und Gemeinsamkeiten sichtbar werden. Vieles war in diesem Jahr schon in Paris zu sehen, in der Stiftung Lafayette Anticipations. Aber zentrale Werke sind aus der Sammlung der Julia Stoschek Foundation, die sich auf zeitbasierte Medien spezialisiert. Die Schau erstreckt sich über alle drei Stockwerke des Baus in der Leipziger Straße im Osten Berlins, der mit seinen rechten Winkeln und großen Glasflächen einst das tschechische Kulturzentrum der DDR beherbergte.
Die Räume sind dunkel und verwinkelt, eigentlich untypische Ausstellungsräume. Der Klang leitet von einer Arbeit zur anderen. Überhaupt, der Sound: Leckeys Themen sind mit Musik verwoben. Aber der Klang der Northern-Soul-Clubs, der Diskos und der Raves im Wald und auf der Wiese erreicht uns nur als Echo, verschnitten mit Sprache, die selbst Teil dieser geisterhaften, traumwandlerischen Musik wird, die man am Waldrand erahnt. Das ist Musik über Musik, und die bildende Kunst kann nicht anders, als immer ein bisschen zu spät zu kommen.
»Während der Pandemie hatte ich eine richtige Glaubenskrise, was Kunst und das Kunstmachen anging«, sagt Leckey. »Ich habe das Interesse und die Hoffnung verloren—und jegliche Lust, irgendetwas zu machen.«
Leckey hat begonnen, Lautsprechertürme zu bauen, als hätte er sich eine Verkörperung dieser komplizierten Vermitteltheit ausgedacht. Ursprünglich benutzte er sie, um seine eigenen Field Recordings aus seiner Nachbarschaft in London abzuspielen. Die Objekte erinnern an die Sound Systems, die jamaikanische Migrant*innen nach Großbritannien gebracht haben—und mit ihnen eine Kultur des Feiern im öffentlichen Raum, mit provisorischen Mitteln. Für seine Installationen aus der Reihe ›BigBoxStatueAction‹, begonnen 2003, stellte der Künstler einen solchen Lautsprecherturm jeweils anderen Skulpturen gegenüber, zum Beispiel in der Londoner Serpentine Gallery einem Standbild von Henry Moore. »Ich kann etwas nur verstehen«, sagt Leckey im Podcast, »wenn ich es konfrontiere, nur durch die Vermittlung komme ich paradoxerweise dem Authentischen nahe.«
Wie eine Variation des Sound System scheint da die Skulptur ›Nobodaddy‹ von 2018. Sie geht auf eine spätmittelalterliche Darstellung des Propheten Hiob zurück, in dessen Wunden der Künstler Lautsprecher gesetzt hat, die ein Stück abspielen, das Leckeys Stimme moduliert. ›Nobodaddy‹ ist ein Zitat, ein Wortspiel aus ›nobody‹ und ›daddy‹, mit dem sich der Lyriker William Blake über die absolute Autorität des christlichen Gottes lustig machte. Ist Leckey etwa auch auf der Suche nach einer ganz anderen, vielleicht religiösen Qualität von Bildern?
Dann änderte sich alles. Ungefähr 2020 wandelte sich unser aller Verhältnis zu digitalen Geräten und ihren Bildschirmen. »Während der Pandemie hatte ich eine richtige Glaubenskrise, was Kunst und das Kunstmachen anging«, sagt Leckey. »Ich habe das Interesse und die Hoffnung verloren—und jegliche Lust, irgendetwas zu machen.« Seine DJ-Sets auf der Musikradioplattform NTS waren sein einziger Ausdruck, während er sich obsessiv mit Ikonografie aus der Zeit kurz vor der Renaissance beschäftigte. Daraus wurde schließlich ›Carry Me into The Wilderness‹ von 2022, die Geschichte des heiligen Antonius im Format eines Social-Media-Videos, ein psychedelischer Trip durch Details von Lorenzo Monacos Darstellung des Einsiedlers, eine Meditation über die Macht des Feeds und der Malerei im Florentiner Quattro-cento—vielleicht auch ein Ausweg aus der Nostalgie.
Der Titel der Ausstellung, ›Enter Thru Medieval Wounds‹, geht auf einen Videoessay des Künstlers zurück. Ein Erzähler berichtet da in brutalen Details, wie ihm die Augen ausgedrückt werden. Reine Fantasie, natürlich, und die Geschichte schlägt gleich den Bogen zur heiligen Lucia und ihren ausgerissenen Augen, sowie zu Konstantin VI., dem byzantinischen Kaiser, der wegen seiner ikonoklastischen Bestrebungen von seiner ikonophilen Mutter geblendet wurde. »Die Sache mit Ikonen ist, dass sie gar keine Bilder sind, sie sind in ihrem Wesen verschieden«, so Leckey. »Ikonen erlauben den direkten Blick in den Himmel, und der Himmel schaut zurück.« Das zehnminütige Stück ist beinahe ein Gegenentwurf zu Leckeys früheren Arbeiten, die mit einem Überfluss an Bildern zu kämpfen hatten, denn hier ist der Bildschirm fast immer schwarz, nur gelegentlich blitzt Goldgrund auf. »Bilder dagegen«, sagt Leckey noch, »erlauben uns immer nur den Blick auf andere Bilder.«
›Mark Leckey: Enter Thru Medieval Wounds‹, Julia Stoschek Foundation Berlin, 11 SEP 2025—3 MAI 2026