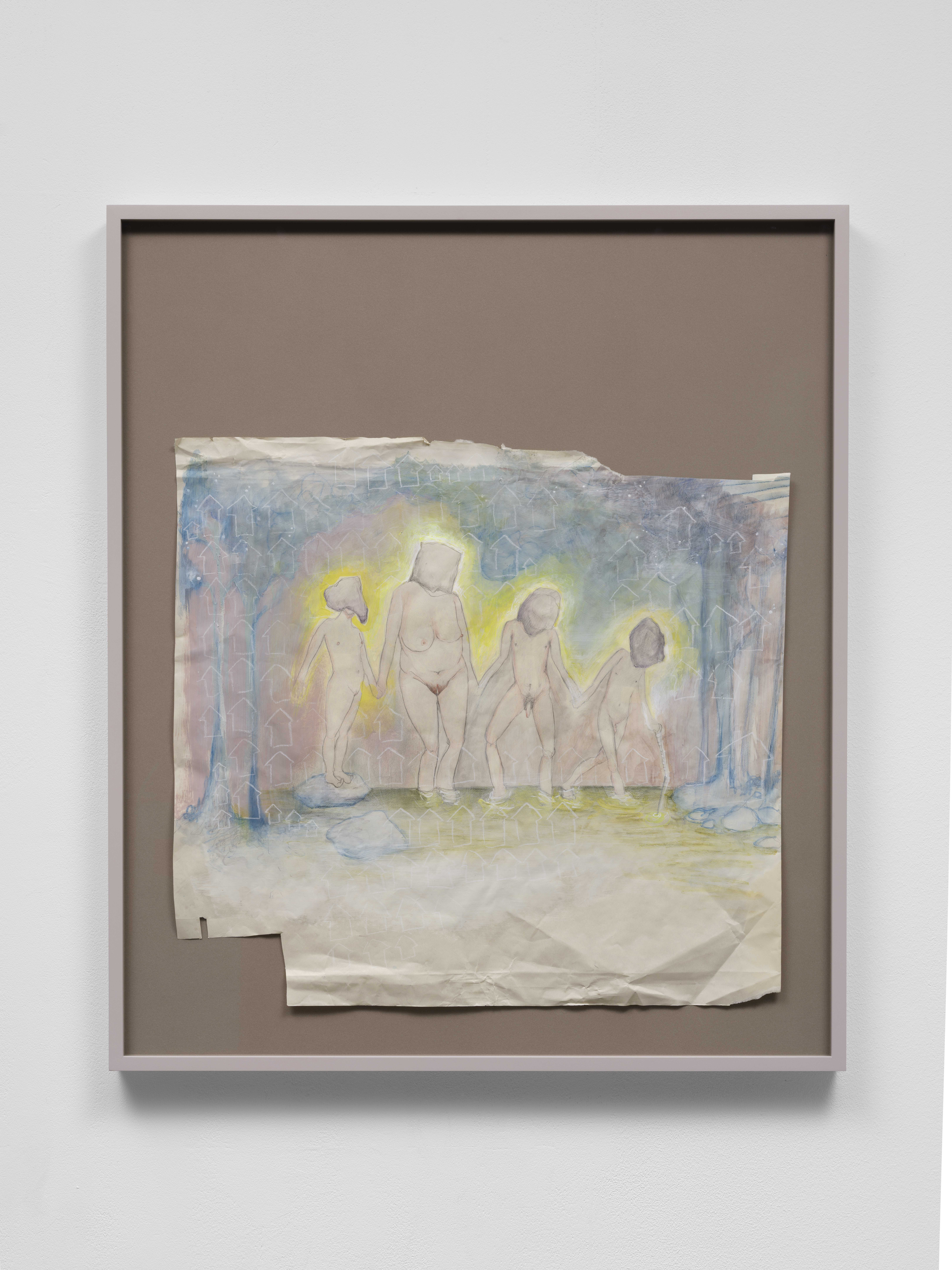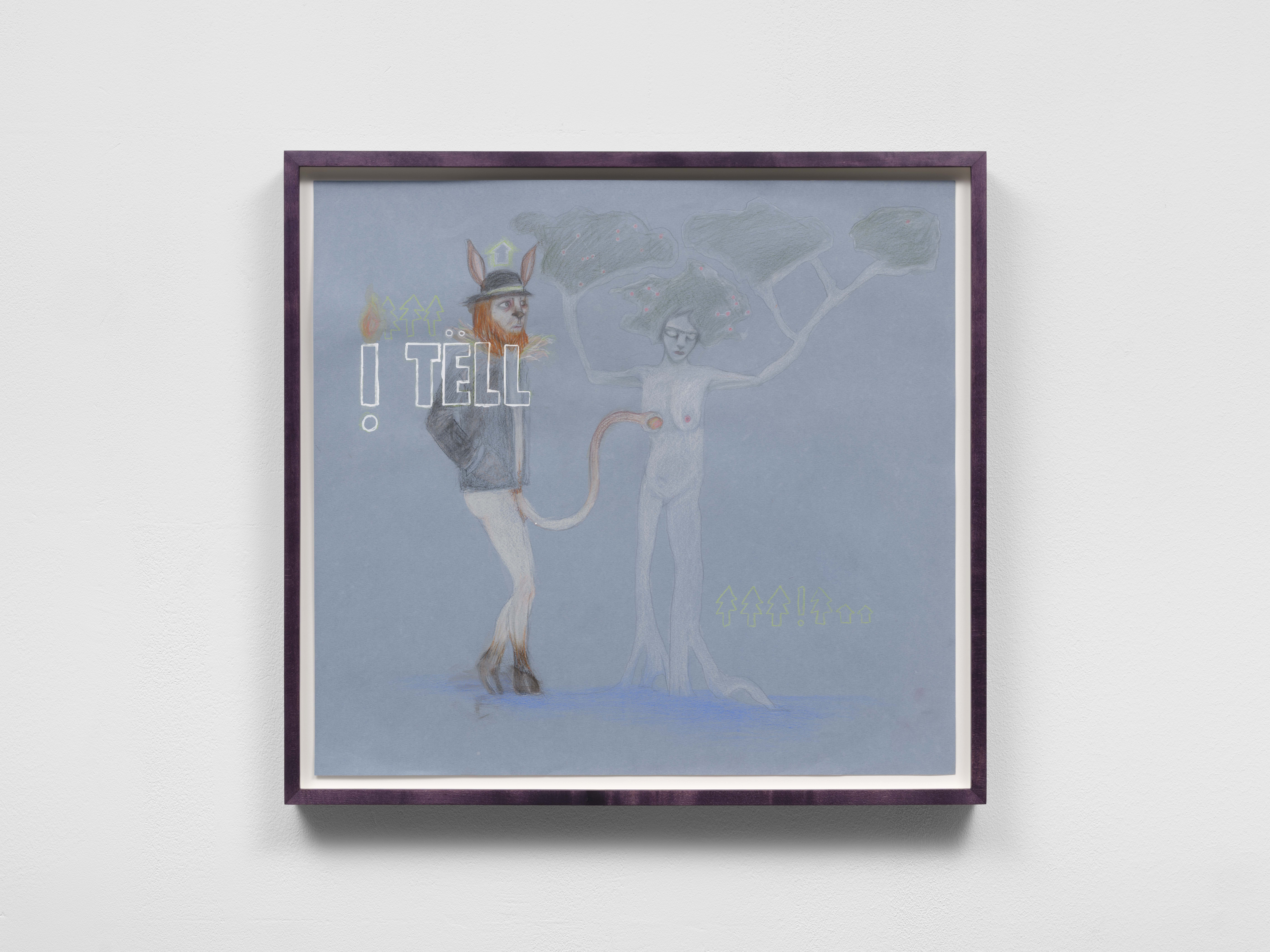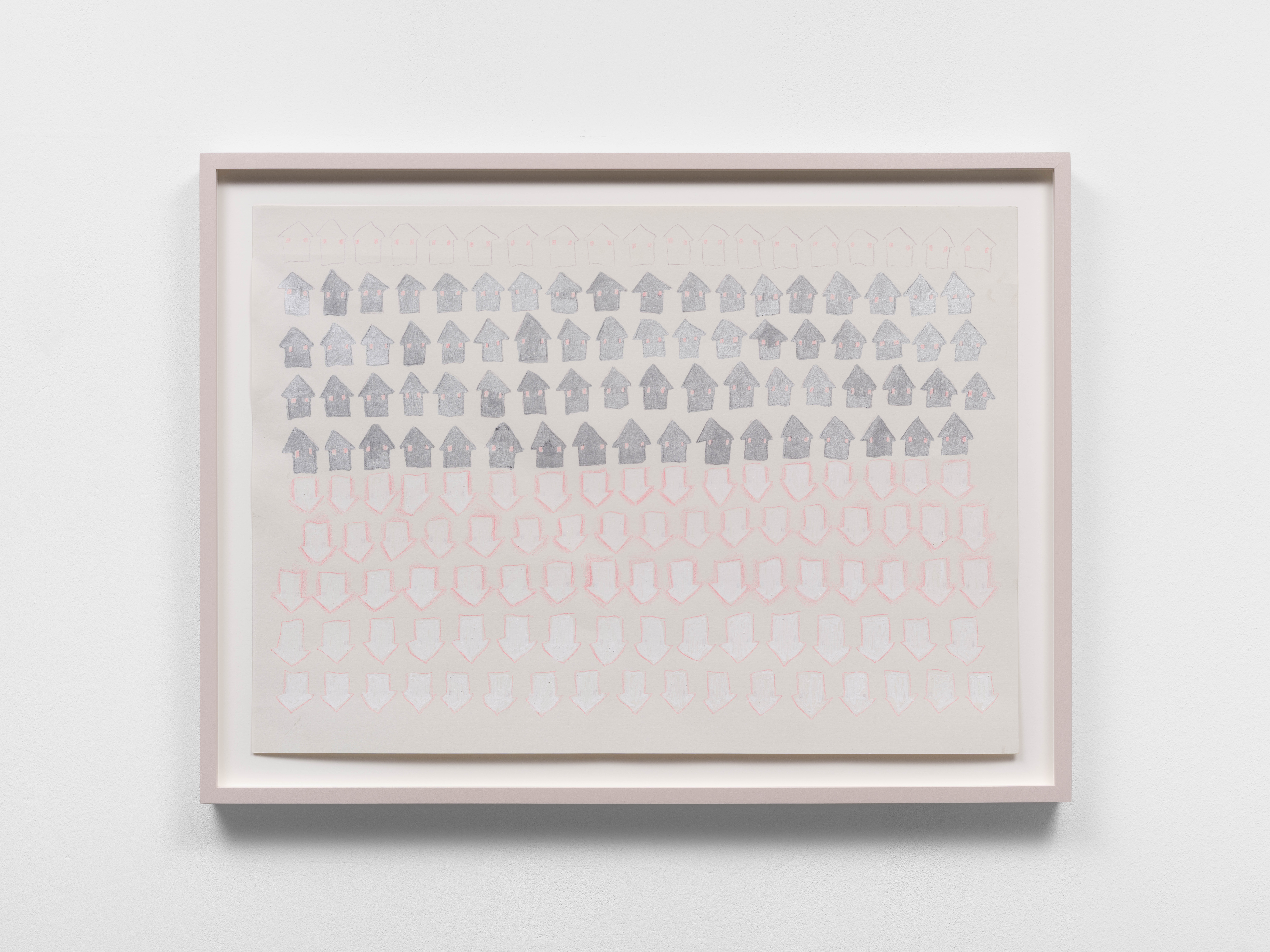Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.
Wenn sich in Jesse Darlings installativen Arbeiten die Absperrgitter auf zerbrechlichen Beinen durchs Leben schleifen und sich Gehhilfen biegen und abknicken, als hätten sie keine Kraft mehr, sich der Schwerkraft entgegenzustrecken, wenn die Fahnenmasten ihre Köpfe hängen lassen, sich mit ihnen der Union Jack matt vor der Erde verneigt, dann werden die Objekte zu lebendigen Wesen, zu fühlenden Kreaturen: »Auch die Dinge haben ihre Tränen und Menschliches rührt das Herz«, sagt Aeneas in Virgils Epos auf der Reise nach Karthago, als er am Tempel des Jupiters Szenen aus dem Trojanischen Krieg erblickt.
Betrachtet man die Installationen des 1981 in Oxford geborenen Künstlers, ist es zunächst kein Krieg, der sichtbar wird. Doch können einige dieser versehrten Objekte in ihrer beseelten Menschlichkeit zu Tränen rühren. Je nach Stimmung der Betrachtenden schleppen sich die stählernen Rohre wie Verwundete durch die Welt, ergeben sie sich erschöpft dem unerträglichen Sein des Erdenlebens oder winden sie sich voll ausgebuffter Devianz unter den Schranken des Normativen hindurch.
Es verwundert nicht, dass Darling für eine dieser Installationen, ›Enclosures, No Medals, No Ribbons‹, 2023 den renommierten Turner-Preis bekommen hat. Darling selbst hält nicht viel von Ehrungen, vom Markt, vom Spektakel. Den Künstler zu fassen zu kriegen, ist ähnlich schwer, wie seine Kunst zu begreifen. Vermittlung reizt ihn ebenso wenig wie Öffentlichkeit oder Statussymbole: Der Turner-Preis sei »nur eine Maschine zur Generierung von Inhalten für die Tate Corporation, und niemand interessiert sich mehr dafür; ich habe es jedenfalls nicht persönlich genommen«, so Darling in einer E-Mail.
»Auch die Dinge haben ihre Tränen und Menschliches rührt das Herz«, sagt Aeneas in Virgils Epos.
Die Kunstwelt jedoch, sie interessiert sich brennend für ihn. Und so ist auch prompt die Galerie Molitor in der Schöneberger Kurfürstenstraße, die nun die erste Einzelausstellung Darlings in Berlin präsentiert—der Stadt, in der er seit 2017 lebt—, für den VBKI-Preis (Verein Berliner Kaufleute und Industrieller) der Berliner Galerien nominiert, der alljährlich zur Berlin Art Week verliehen wird.
In der Ausstellung mischen sich installative Elemente mit Zeichnung und Skulptur, wie die Arbeit ›Limping Cabinet‹—humpelnder Schrank. Aufgebahrt in einer eleganten Holzvitrine, bei der ein Bein durch das Unterteil einer Krücke ersetzt wurde, liegen drei Leitz-Ordner im typischen Wolkenmarmor-Umschlag, in allen dreien schläft statt gehefteter Papiere ein Block gegossener Beton. Ist es die Gewalt der Bürokratie, die um jeden Preis gestützt werden muss? In deren staubiger Unauffälligkeit sich das Elend von Masse und Individuum manifestiert? Ob Abschiebepolitiken, staatliche Antragspflichten bezüglich Identitätsfragen, die Maschinerie der Arbeitskraftverwaltung, Überwachungsstaaten oder die Vernichtungsbürokratie der Nationalsozialisten: Die versteinerten deutschen Aktenordner rufen erdrückende Assoziationen hervor. Doch wäre es zu einfach, sie eindeutig als mahnenden Schrecken abzutun. Wie in den meisten Arbeiten Darlings lauert irgendwo augenzwinkernd die Utopie: Sie könnten auch das Museumskabinett einer ungewissen Zukunft sein, in der es die Erinnerung ist, die der Stütze bedarf.
Auch in seinen selten gezeigten farbigen Zeichnungen, die nun bei Molitor zu sehen sind, scheint das Vergangene allgegenwärtig. Weiße Outlines formen die Worte ›I Tell‹, schweben vor zwei Kreaturen, die mit Penis und Brust verbunden sind wie durch eine Nabelschnur. Ein nackter Körper wird zum Baum, eins der Wesen trägt Jacke und Hut, die faunartigen Hufe wie High Heels. Die zentrierte Komposition und der naive Strich erinnern an Teenager-Ästhetiken. Auch andere der gezeigten Papierarbeiten stellen menschenähnliche Figuren in den Vordergrund, deren Kampf mit der Körperlichkeit unübersehbar ist.
Widerstand wird eingespeist
Es fällt schwer, Darlings Zeichnungen nicht autobiografisch zu interpretieren—eine Lesart, die er jedoch weit von sich weist. Seine allgegenwärtige Abweisung scheint tief empfunden, auch wenn sie paradoxerweise die Idee des selbstbezogenen Künstler-Genies noch befeuert: Es gibt kein Entkommen aus der perversen Warenlogik des Marktes. Wie eine Zwangsjacke verfestigt sich der verkäufliche Mythos, je mehr der Künstler dagegen kämpft. Also leiden die Wesen in Darlings Arbeiten, sie leben, kriechen und weinen, bis aus ihnen Aggression, Aktivismus und Vereinsamung krümeln. Die süße Naivität der Kindheit, sie existiert nur, um an der kaputten materialistischen Welt der Erwachsenen zugrunde zu gehen.
Es ist die unverstellte Direktheit dieses Gefühls, die Darlings Arbeiten so verlockend macht. Sie erhebt diese aus dem Vorwurf, ein Remix schon vorhandener Werkkörper wie derer Tatiana Trouvés, Sylvie Fleurys, Isa Genzkens oder Robert Gobers zu sein. Und wenn Darling in seinen ›Vanitas‹-Installationen die opulentesten Blumen in luftdichten Kästen verrotten lässt, bis nur noch schimmliger Verfall hinterm Glas lauert, dann ist der Krieg in diesen trojanischen Pferden der Schönheit doch spürbar. Und mit ihm die schäbige Gleichzeitigkeit von Kunstmessen und Drohnenangriffen, Ehrenpreisen und Abschiebeknästen, Biennalen und zerfetzten Körpern und das allumfassende Leiden an einem System, dem man nicht entkommen kann—auch Jesse Darling nicht.
Jesse Darling, Galerie Molitor, 12 SEP—8 NOV 2025