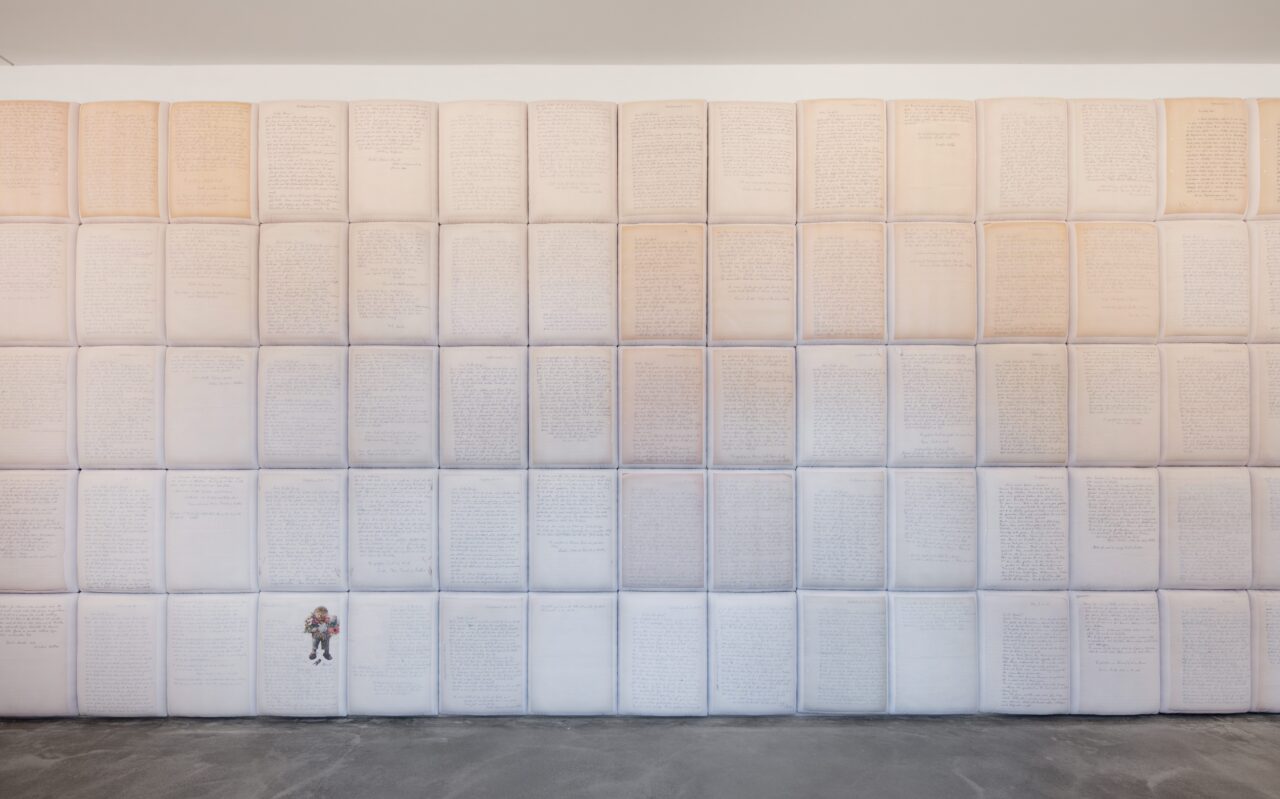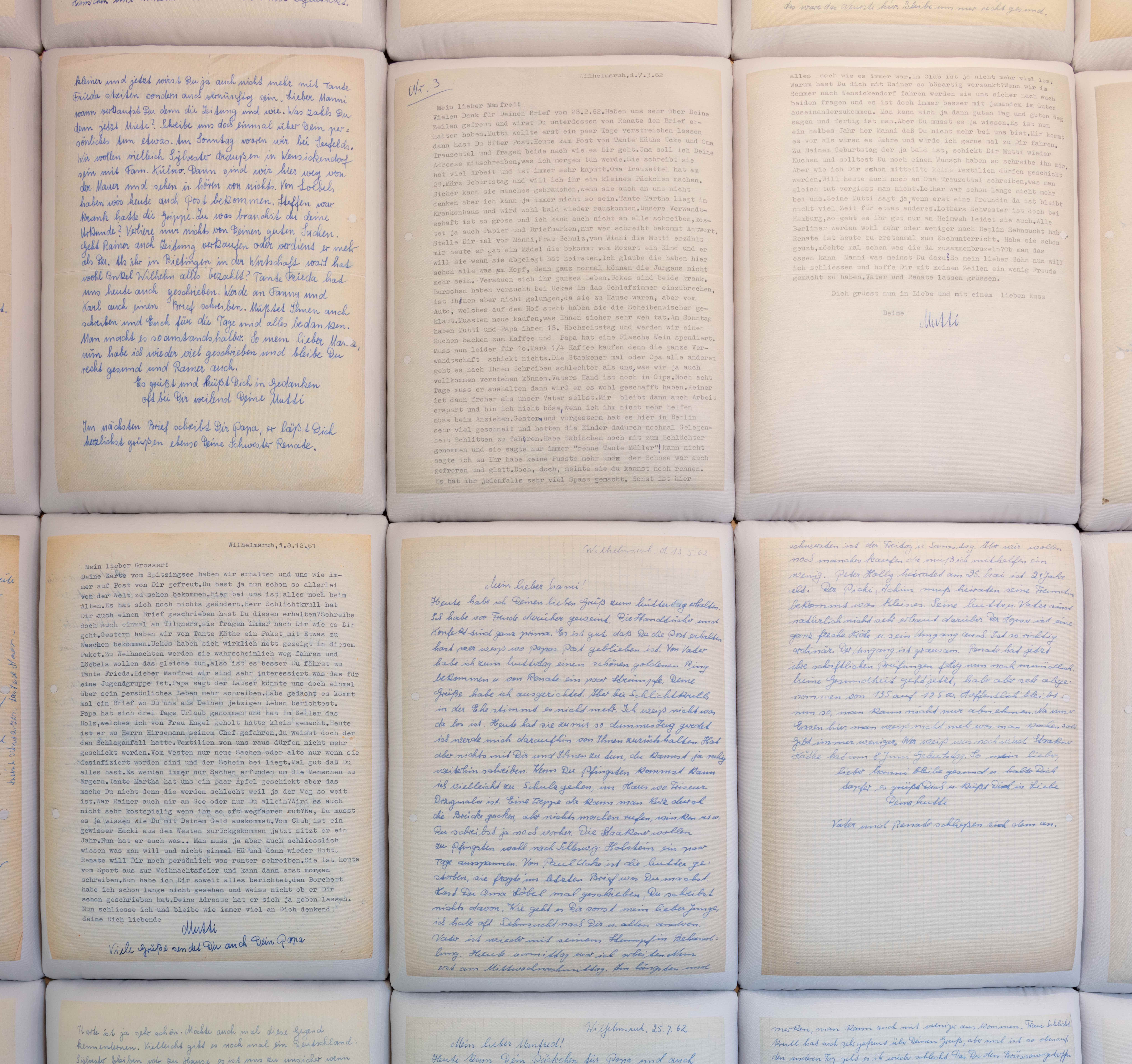Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.
Das, was ihr der Alltag in die Hände spielt, wird zu Kunst. Jüngst zeigte Alex Müller in ihrer Einzelschau ›Alexandraplatz‹ in der Zitadelle Spandau, dass sie von der Malerei bis zur kinetischen Skulptur sämtliche Medien beherrscht. Die Installation ›Von der Hand an die Wand‹, die dort zu sehen war, zeigt 340 Briefe, die Müllers Familie aus der DDR an ihren Vater in den Westen schickte. Ihre Berliner Galerie Haverkampf Leistenschneider zeigt diese Arbeit nun zur Berlin Art Week in der Gruppenschau ›Hallen 06‹ in den Wilhelm Hallen in Reinickendorf—wenige Meter entfernt von dem Ort, wo Müllers Vater 1961 aus dem Osten in den Westen geflohen ist.
der Freitag: Ihre letzte Ausstellung ›Alexandraplatz‹ in der Zitadelle Spandau umfasste 56 Arbeiten. Ihr Werk scheint sehr umfangreich zu sein?
Alex Müller: Woraus ich schöpfen kann, bedingt ja das Leben. Wenn du dich nicht viel bewegst, kommt nicht viel zu dir. Meine Kunst hatte von Anfang an autobiografische Züge, verbunden mit Recherchen, zum Beispiel aus Filmen von Peter Greenaway und Stanley Kubrick oder Texten von Molière. Das Erleben steht im Vordergrund, nicht nur das Autobiografische. Im Studium habe ich mal den höchsten Berg von Madeira gehäkelt, nachdem ich auf den Gipfel gestiegen bin. 1.183 Meter, das wurde dann später eine Kugel.
Die ist gar nicht so groß, wie man denken könnte. Sie haben sie 2023 in der Kunsthalle Nürnberg wieder ausgestellt.
Die Arbeit ist mir sehr wichtig. Alltäglichkeit steht für mich immer stärker im Fokus. Das Erlebte— gekoppelt mit dem, was man als Erinnerung betrachtet. Das macht die Menschen aus. In der Alltäglichkeit fängt die Lebendigkeit an. Vielleicht ist das so eine Art von positiver Erinnerungsradikalität.
Ist Erinnern ein Aussieben?
Erinnern ist nicht willkürlich. Unser Erleben im Jetzt lenkt, welche Erinnerungen hochkommen. Oft tauchen sie auch überraschend auf. Viele Künstler*innen arbeiten aktuell mit Erinnerungen. Der Alltag ist das, was uns ausmacht. Die Menschen, die da vorne sitzen. Wie wir beide hier sitzen, unsere Kommunikation. Das ist von höchster Wichtigkeit. Dadurch können wir etwas verändern. Es ist nicht nur das Zeigen von etwas. Sondern das, was hier stattfindet.
Zur Berlin Art Week zeigen Sie in den Wilhelm Hallen Ihre Arbeit ›Von der Hand an die Wand‹. Das ist eine Installation mit den Briefen, die Sie von Ihrem Vater geerbt haben. Was steckt dahinter?
Ich bin in Düren groß geworden, und die Mauer war jeden Tag Thema, obwohl sie 670 Kilometer entfernt von uns war. Mein Vater ist mit 17 Jahren aus der DDR abgehauen, meine Großmutter hat ihm das nie verziehen. In Düren war mein Vater der Flüchtling. Durch die Pakete an die Tante, die Cousins und die Großeltern sowie durch die Briefe meiner Großeltern und Tanten an meinen Vater war die Mauer immer da.
Warum ist Ihr Vater abgehauen?
Wegen familiärer Konflikte. Er hat sich mit seinem Vater nicht gut verstanden und er hatte einen Freiheitsdrang. 180 Meter von dem S-Bahnhof entfernt, wo mein Vater über den Zaun geklettert ist, sind heute die Wilhelm Hallen. Ist doch absurd, dass ich da jetzt ausstelle. Mit anderthalb Jahren bin ich mit meiner Mutter das erste Mal rübergefahren, um mich der Familie vorzustellen. Meine Großeltern haben in einem Mehrfamilienblock gelebt, der ist nur 450 Meter enfernt von den Wilhelm Hallen. Der Ausstellungsort liegt wirklich direkt neben dem Ort, an dem die Briefe geschrieben wurden. Sie jetzt dort zu zeigen, ist wie eine Art Abschluss, eine Art Allgemeingültigkeit.
340 Briefe von der Familie im Osten an den Sohn im Westen. Zwischen getrennten Ländern geschrieben, mit Alltäglichkeiten und Vorwürfen. Sie haben diese Briefe auf Kissen gedruckt und an die Wand gehängt.
Briefe, in denen auch ich vorkam. In dieser Darstellung der anderen fängt mein Leben an. Die Briefe habe ich auf abwaschbare Baumwolle drucken lassen und diese dann ähnlich wie Sitzkissen befüllt. Wir sitzen nicht auf der Geschichte, sondern wir nehmen sie in die Hand. Als Konfrontation. Diese Arbeit ist eine Einladung dazu. Sie soll kein Denkmal setzen, sie ist keine Einladung, sich auszuruhen. Sie ist ein Echo.
Dazu gehört auch eine Soundarbeit.
Die habe ich mit dem Komponisten Alexander Wienand gemacht. Für die Soundarbeit lese ich die Überschriften und die Datierung der Briefe vor. Wie meine Großmutter immer wieder versucht, eine Wiederholung zu vermeiden. Sie schreibt abwechselnd: ›Mein lieber Sohn‹, ›mein lieber, lieber Sohn‹, ›mein Bübele‹. Förmlichkeit und Varianz.
Sie waren bis ins jugendliche Alter mehrmals jährlich in der DDR.
Die DDR wurde zu meiner Heimat, weil ich so oft da war. In den Osterferien, in den Sommerferien. Im Freibad in Pankow bin ich das erste Mal vom Zehnmeterturm gesprungen. In Düren gab es keinen. Ich weiß nicht, wie oft ich in Wilhemsruh im Kino war. Ich wollte auch in die DDR ziehen. Ich fand es dort viel besser. Meine Oma hat bei einem Bäcker gearbeitet, da gab es immer Streuselschnecken und ich bin gern im Konsum einkaufen gegangen.
Und haben Sie die Unterschiede auch negativ wahrgenommen?
Ich habe mich immer bemüht, mich so zu kleiden, dass ich gar nicht als sogenannte Westschnecke aufgefallen bin. Ich habe meine ältesten Adidas-Turnschuhe angezogen. Und ich habe das Label an Jeans abgemacht, weil ich Teil der Community sein wollte.
Und, hat das geklappt?
Je älter wir wurden, desto weniger. Deswegen wollte ich irgendwann auch nicht mehr in die DDR. Die Freunde gingen zur FDJ (Freie Deutsche Jugend). Und die Jungs zur Armee. Ich wurde mir der Lage immer bewusster. Meine Großeltern haben sehr darunter gelitten, dass mein Vater gegangen ist, und ich wurde sozusagen hingeschickt als ›Wiedergutmacheengel‹, so heißt auch eine Arbeit, die in der Zitadelle gegenüber von den Briefen hing—eine Lederjacke, die ich auch von meinem Vater geerbt habe, gemeinsam mit den Briefmarken, die ich auf der Jacke angebracht habe.
Glauben Sie an transgenerationelle Traumata?
Was heißt glauben? Ich habe sie erlebt.
Ihre Arbeiten sind narrativ. Gibt es einen Unterschied zwischen Ihrer Malerei und den Skulpturen? Funktioniert das Erzählen anders?
Es ist ein Unterschied, ob ich ein Müsli esse oder eine Scheibe Brot. Mein Ausgangspunkt sind die Malerei und die Zeichnung. Aber ich wollte mich nie festlegen. Es gibt so Zyklen, da widme ich mich mehr der Malerei, wenn dann diese Phase abgeschlossen ist, dann kommt vielleicht ein installativer Gedanke, oder ich schreibe. Ich beschäftige mich schon seit Langem mit Lyrik.
Was war das Schönste, das jemals jemand über Ihre Kunst geschrieben oder gesagt hat?
Als mein Sohn sechs Jahre alt war, stand er mal im Atelier und sagte: »Das Bild da können wir gar nicht aufhängen, das ist ja so schön.« Ich glaube, das war das schönste Kompliment.
Der Kritiker Oliver Koerner von Gustorf hat in der ›Monopol‹ geschrieben, Ihre Bilder sollten in internationalen Museen hängen.
Das sehe ich auch so. Das ist auf eine andere Art schön.
Vor Ihnen liegt ein großes Notizbuch. Was schreiben Sie da rein?
Ich fange die Bücher immer von hinten an, und dann stehen da Ideen drin. Dinge, die ich recherchiere, die ich gebrauchen kann, die sich für mich plausibel anhören.
Skizzen auch?
Die mache ich eher auf Skizzenblättern.
Was davon wird zur Malerei, was zur Skulptur?
Wenn ich male, brauche ich Widerstand. Ich fange an zu malen, lege es dann weg und denke: »So, das ist gescheitert.« Und dann gibt es den Moment, an dem ich mir das Bild wieder nehme. Dann sehe ich es neu und kann darauf reagieren. Das ist für mich ein Widerstand, es gibt bereits eine Behauptung. Die führt mich dann meist zum Ziel. Nicht immer, aber sehr oft.
Sie malen mit Tusche.
Ich mag keine Ölfarbe, wegen dieser Cremigkeit. Das liegt, glaube ich, daran, dass meine Mutter mir früher immer das Gesicht mit Bebe-Creme eingecremt hat. Ich weiß noch, wie ihre Technik war.
Da ist wieder die Alltäglichkeit.
Es gibt von Hannah Arendt ein schönes Zitat zur Biografie. Sie hat gesagt, wer handelt, beginnt etwas Neues. Das ist es, was mich seit einigen Jahren in allen möglichen Bereichen trägt. Ich möchte eben nicht das Rad neu erfinden, aber dazu beitragen, dass es sich dreht. Was ich mache, ist ein Echo. Meine Arbeit eröffnet den Blick auf etwas, das wir nicht wissen, und dieses Nichtwissen ist so wichtig in unserer Zeit. Nicht zu wissen, was mir in einer Ausstellung eventuell passieren könnte. Der Konjunktiv.
Haben Sie sich mal geschämt für das Autobiografische in Ihrer Kunst?
Nein. Es braucht natürlich eine Neugierde, und die ist nicht immer angenehm. Ich möchte schon viel wissen, auch in Freundschaften. Mich interessiert der Mensch. Man darf keine Angst davor haben, was dabei rauskommt.
›Alex Müller: Von der Hand an die Wand‹, Hallen 06, 6—14 SEP 2025