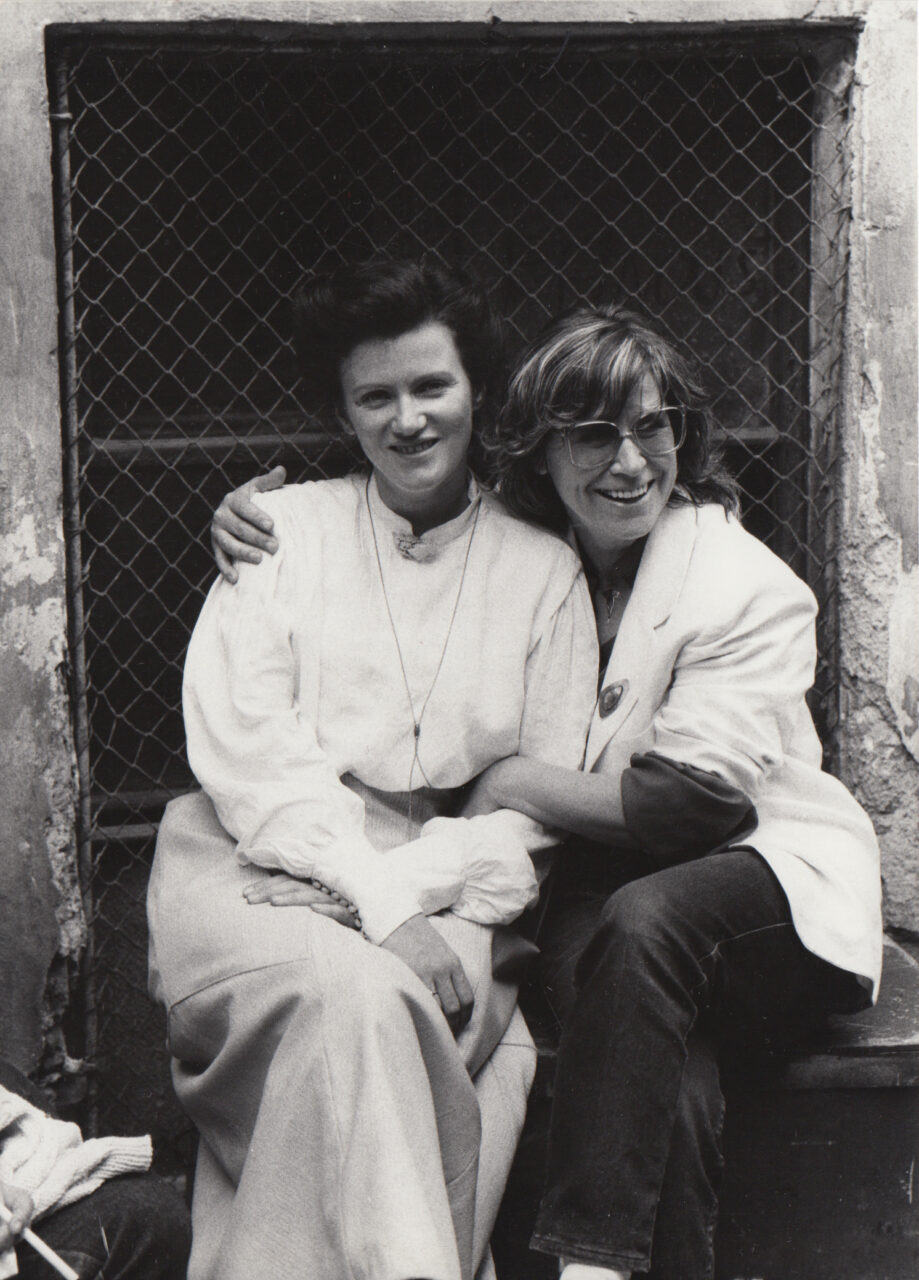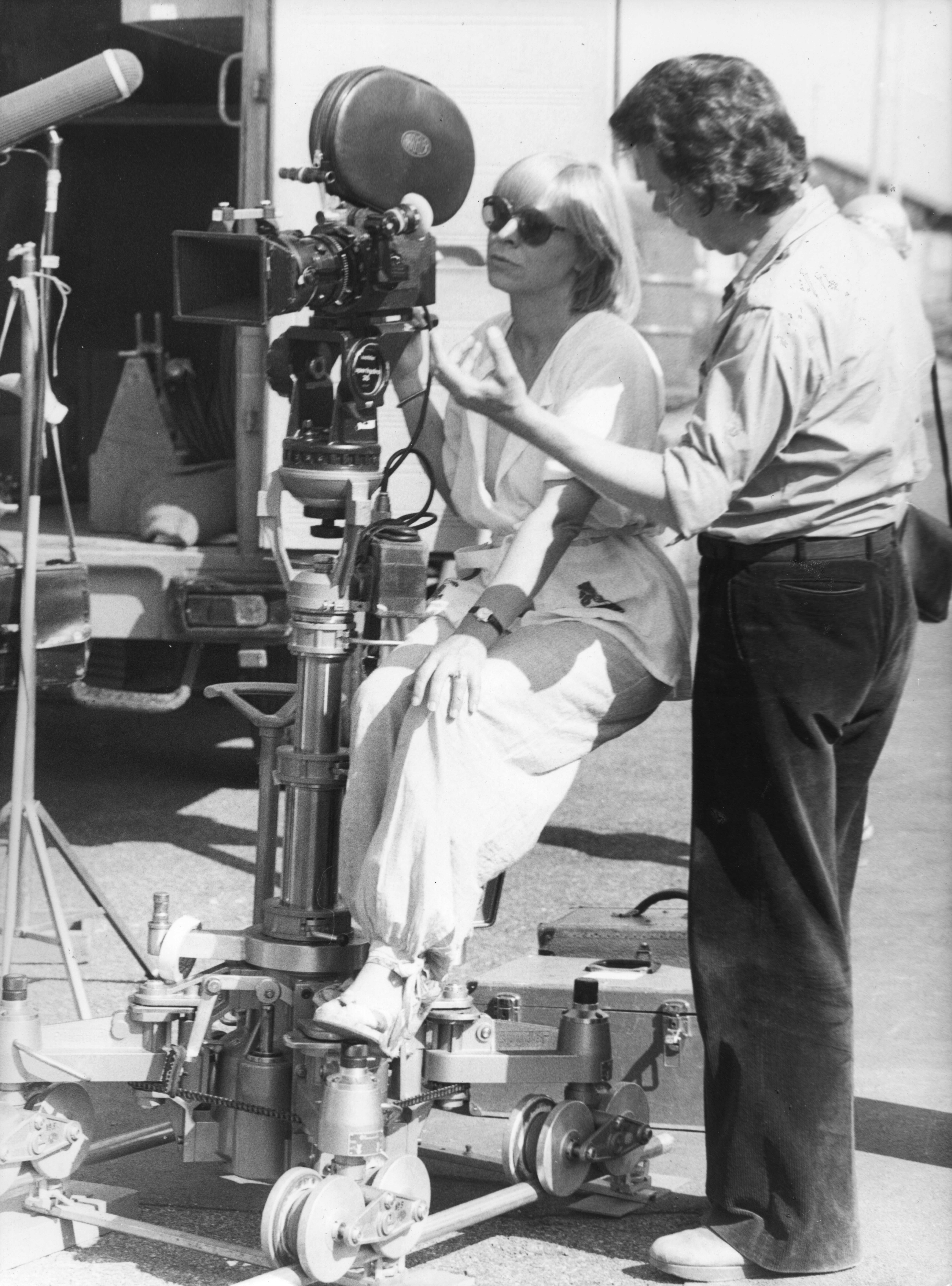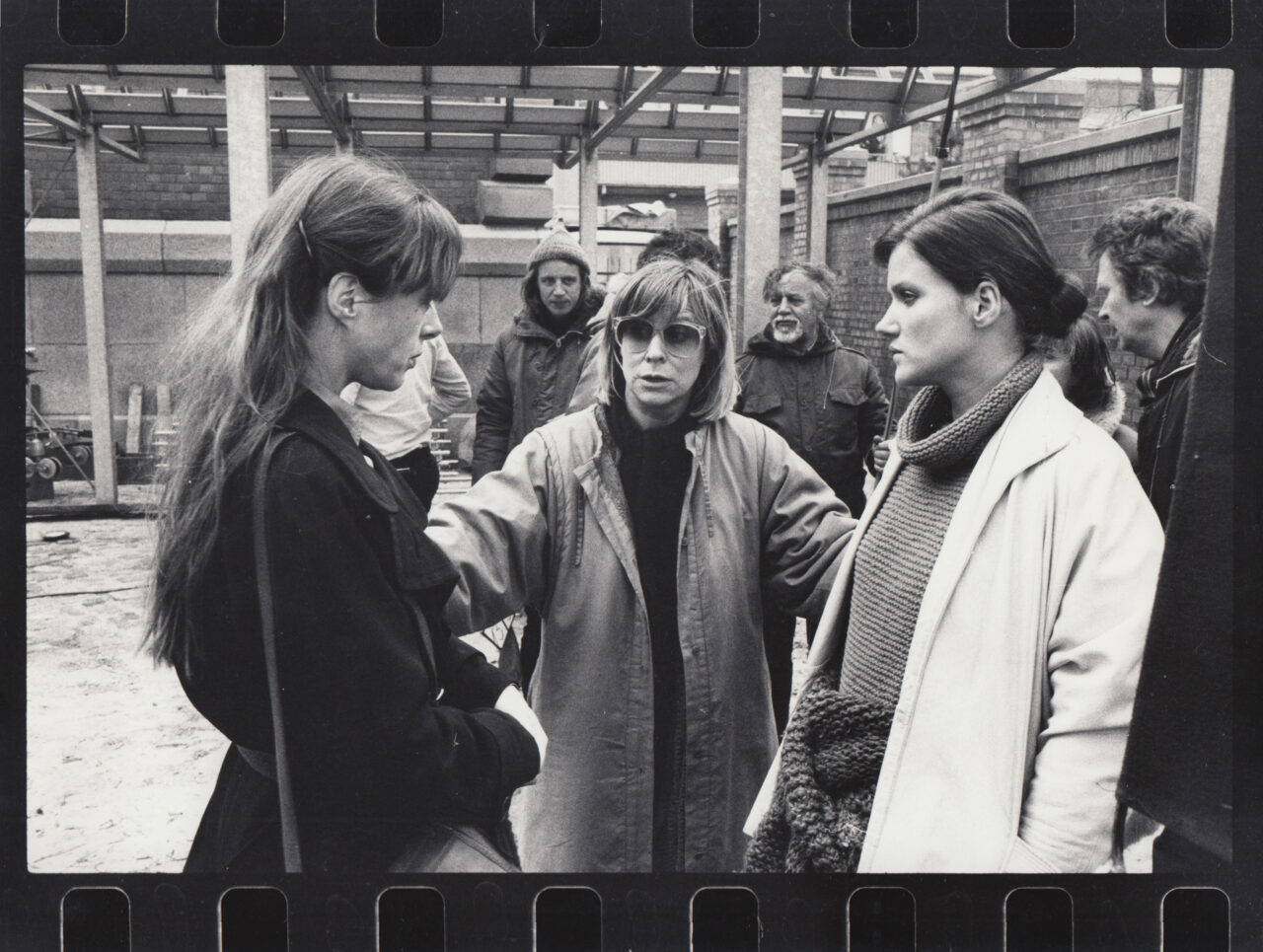Dieser Artikel erschien zuerst in der Berlin Art Week 2025 Sonderausgabe des Freitag.
Ulrike Ottinger, Harun Farocki, Pier Paolo Pasolini—seit vielen Jahren würdigt der Neue Berliner Kunstverein (n.b.k.) Filmemacher*innen in seinem Ausstellungsprogramm. Die Idee und der Wunsch, eine Ausstellung mit Margarethe von Trotta zu realisieren, begleitete den Direktor des n.b.k., Marius Babias, schon lange. Ein Anruf, ein Koffer und eine Taxifahrt durch Berlin ließen sein Vorhaben nun Wirklichkeit werden: Denn zur diesjährigen Berlin Art Week eröffnet im n.b.k. eine umfangreiche Retrospektive der Filmemacherin Margarethe von Trotta.
Mit ihrem rund 50-jährigen Schaffen gilt von Trotta, die 1942 in Berlin geboren wurde und bis in die 1960er Jahre staatenlos war, als international bekannteste und renommierteste deutsche Autorenfilmerin. Ausgehend von der deutschen Geschichte und von historischen Frauenfiguren wie Hildegard von Bingen, Rosa Luxemburg, den Ensslin-Schwestern oder Hannah Arendt reflektieren ihre Filme das Verhältnis von Privatem und Politischem. Aus feministischer Perspektive widmet sie sich einem kritischen Diskurs über Gesellschaft, Geschichte und Gegenwart und bekräftigt dabei eine Lebensführung des eigenständigen Denkens.
Margarethe von Trottas Schaffen, das in der Tradition des Neuen Deutschen Films steht, wurde vielmals, doch vorrangig in Frankreich, Italien und den USA ausgezeichnet und mit Preisen und Ausstellungen geehrt. Die von Marius Babias und Michaela Richter kuratierte Schau im n.b.k. stellt nun die bislang umfangreichste Ausstellung Margarethe von Trottas in Deutschland dar. Im Fokus stehen ihre Arbeiten für das Kino: Zahlreiche Filmausschnitte aus insgesamt zehn Filmen werden begleitet von zum Teil bislang unveröffentlichten Fotografien, Drehbuchfassungen und Tagebuchauszügen sowie von Filmplakaten, Publikationen und Presseberichterstattungen, die von Trottas filmische Bilder kontextualisieren und die Erzählweisen ihrer Filme näherbringen. Zu diesen zählen zum Beispiel ihre frühen Filme wie ›Die verlorene Ehre der Katharina Blum‹ (1975), an dem sie mit ihrem damaligen Ehemann Volker Schlöndorff als Co-Regisseurin arbeitete, bei Veröffentlichung des Filmes als diese aber nicht genannt wurde; oder ›Das zweite Erwachen der Christa Klages‹ (1978), mit dem sie sich als Regisseurin emanzipierte und von da an starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt ihrer Handlungen stellte. Die intensive Auseinandersetzung der Filmemacherin mit einflussreichen Denkerinnen erhält in der Ausstellung ebenso ein Augenmerk wie ihre kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen wie Angela Winkler, Jutta Lampe, Katja Riemann und Barbara Sukowa. Die Ausstellung unterstreicht die Selbstermächtigung der Margarethe von Trotta, die ihre künstlerische Arbeit zunächst als Theaterschauspielerin und dann in Filmen von Rainer Werner Fassbinder aufgenommen hat, und gibt ihrem Werk in einer von Ola Zielińska gestalteten Ausstellungsarchitektur Raum, weitergedacht zu werden. Dabei wird deutlich, welche Wege ihre Arbeit für nachfolgende Generationen an Künstler*innen geebnet hat.
In einer die Ausstellung begleitenden Werkschau im Babylon Kino (Rosa-Luxemburg-Straße 30) werden ausgewählte Filme Margarethe von Trottas gezeigt, darunter die prämierten Filme ›Die bleierne Zeit‹ (1981) und ›Rosenstraße‹ (2003), in denen sie sich mit der deutschen Geschichte von nationalsozialistischer Herrschaft und RAF-Terrorismus auseinandersetzte. Ihre Filme berühren immer wieder die Frage, welche Antworten Menschen auf die jeweiligen gesellschaftlichen Machtverhältnisse ihrer Zeit finden und formulieren.
Filme über die Stadt Rom
Von Trottas Retrospektive stellt Marius Babias im n.b.k. Showroom die Premiere des ersten Essayfilms von Katerina Poladjan und Henning Fritsch anbei: ›Ancora un dialogo di Roma‹, der Bezug auf den Film ›Il dialogo di Roma‹ (1982) von Marguerite Duras nimmt. Duras’ ›Dialog von Rom‹ zeigt eine Kamerafahrt durch Rom, begleitet von einer Unterhaltung zwischen einer Frau und einem Mann, einem Paar. Das Neben- und Miteinander, das Duras’ Bilder entlang von innerstädtischen Landschaften, Gewässern oder Gebäuden wie dem Palazzo Farnese eingefangen haben, wird von den Stimmen aus dem Off gespiegelt. Die Schriftstellerin und Filmemacherin Marguerite Duras, die neben weiteren Filmemacherinnen wie Susan Sontag zu Beginn der 1980er Jahre in Italien mit einem städtischen Porträt beauftragt worden war, wollte mit ihrem Film über Rom Kritik am Bild des antiken Imperialismus und dem Männlichkeitswahn dieser Stadt üben.
Die Schriftstellerin Katerina Poladjan, geboren 1971 in Moskau, überschreibt nun mit dem Regisseur und Autor Henning Fritsch, geboren 1972 in Kassel, Duras’ Vorlage mit einem eigenen Narrativ: Denn ausgehend von einem gemeinsamen Aufenthalt an der Villa Massimo in Rom begaben sich die beiden auf Poladjans Spuren durch die italienische Hauptstadt, wo diese als Kind lebte. Der mit einem Mobiltelefon aus der Hand gedrehte Film fängt so etwa Bilder aus dem Vorort Ostia ein, wird assoziativ überlagert von einer Stimme, die von persönlichen Erfahrungen in Verbindung mit ›eigenen‹ und ›fremden‹ Plätzen erzählt und einen intimen Dialog zwischen Wort und Bild schafft.
Die Verortung des Selbst, die ebenso für Margarethe von Trottas Werk wichtig ist, erhält mit Poladjans und Fritschs Film, der Migration und Fremdsein feinfühlig in den Blick rückt, einen zeitgenössischen Ausdruck. Und Poladjans Ausdruckskraft ist feministisch. So zuletzt in ihrem Roman ›Zukunftsmusik‹ (2022), der durch vier Frauengenerationen einer Familie vom Lebensalltag in einer Kommunalka und dem politischen Wandel der Sowjetunion im Jahr 1985 erzählt—und der 2026 am Berliner Maxim Gorki Theater adaptiert werden soll. Ihr Roman ›Goldstrand‹, für den sie den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds 2025 erhalten hat, ist erst kürzlich erschienen.
Sprache im öffentlichen Raum
Durch Ausstellungsflächen im öffentlichen Raum spricht der n.b.k. seit einigen Jahren auch direkt in die Gesellschaft hinein. So zeigt die Fassade des n.b.k., die einmal jährlich von Künstler*innen gestaltet wird, nun mit ›they filled me up with words‹ ein Sprachbild von Nora Turato: Sechs Paneele oberhalb der Fenster des Kunstvereins zeigen Schriftbilder der 1991 in Zagreb geborenen Performancekünstlerin. Sie basieren auf ihrer Handschrift und sind aus der Werkreihe ›pool‹ hervorgegangen. ›pool 1—6‹ ist eine Sammlung, die Turato aus gefundenen Texten und Sprachfragmenten jährlich in Berichten gruppierte und aus denen sie ihre typografischen Schriftbilder und performativen Arbeiten generierte. In ›pool 7‹ überführte sie ihre Sammlung erstmals in eigene Worte und in eine Performance, die ihren ›Sprachkonsum‹ der vergangenen Jahre in Bezug zum eigenen Körper reflektiert. Turato, die bereits 2023 zur Berlin Art Week mit einer Schau in der Galerie Sprüth Magers vertreten war, weist mit ihrer Arbeit auf gesellschaftliche Entwicklungen hin, die in Verbindung mit dem Gebrauch von Sprache stehen, und befragt, wie Sprache Körper formt und konditioniert. Ihr eigens für die Fassade des n.b.k. entwickeltes Sprachbild wird an ausgewählten Terminen durch eine Performance begleitet. Diese ist Teil der Fassadenpräsentation, die von Lidiya Anastasova kuratiert wurde.
Das n.b.k. Billboard an der Kreuzung Friedrichstraße und Torstraße—gleichfalls von Anastasova kuratiert—wird durch einen Beitrag von Patti Smith und Stephan Crasneanscki bespielt: Die Musikerin und Dichterin Smith, 1964 in Chicago geboren, und der Klangkünstler Crasneanscki, 1969 in Grenoble geboren, vollziehen mit ihrem Gemeinschaftsprojekt ›Correspondences‹ einen fortlaufenden Dialog, etwa indem Crasneansckis Klangaufnahmen zur Grundlage für Smiths Gedichte werden. Auf dem Billboard zeigen sie eine audiovisuelle Arbeit aus dieser Reihe, die sich auch auf das Filmarchiv Jean-Luc Godards und den Schriftsteller Pjotr Alexejewitsch Kropotkin bezieht, der sich für eine herrschaftsfreie Gesellschaft einsetzte. Patti Smiths Gedichte ›Cry of the Lost‹ und ›Prince of Anarchy‹ sind auf dem Billboard über einen QR-Code als Audioaufnahme zugänglich. Smiths Stimme steht in unmittelbarem Vis-à-vis zu der Collage, die sich über die Bildfläche des Billboards in den urbanen Raum Berlins einschreibt. Dem n.b.k. ist mit diesem feinsinnig abgestimmten Programm ein Coup gelungen: Denn die Bedeutung der Weise, wie wir miteinander sprechen, wird hier medien- und generationenübergreifend präsent.
›Margarethe von Trotta‹, n.b.k.,
11 SEP—9 NOV 2025
›Katerina Poladjan, Henning Fritsch: Ancora un dialogo di Roma‹, n.b.k. Showroom, 11 SEP—9 NOV 2025
›Nora Turato: they filled me up with words‹, n.b.k. Fassade, 11 SEP 2025 —31 AUG 2026
›Stephan Crasneanscki, Patti Smith: Cry of the Lost | Prince of Anarchy‹,
n.b.k. Billboard, 11 SEP 2025 —22 FEB 2026